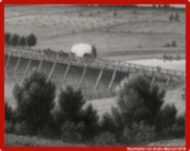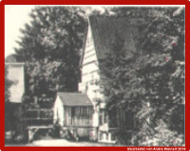Wahrenbrück Damals
Die Schwarze Elster
Die Schwarze Elster vom
Sibillen-oder Hochstein im Lausitzer Gebirge kommend, hat ihre Quelle in der Nähe des Dorfes Elstra.
Durch unser ebenes und flaches Land, trat sie oft über ihre Ufer und bildete sumpfige Niederungen.
Das Wasser floß hier träge durch viele kleine Gräben, wie schon Otto d. J. von Ileburg beim Kauf der
Insel Namens Horst berichtete. Die kleine Elster, auch Dober genannt kommt aus dem Kreis Luckau und mündet
in Wahrenbrück.
Das Rathaus
Das alte Rathaus stand
früher in der Ortsmitte und ist 1714 einem Brand zum Opfer gefallen. Wahrenbrück erlitt 1678, 1707, 1710 und
1714 großen Schaden durch Brände.
Das Stadttor
Zolleinkünfte waren ein
wichtiger Bestandteil der Wirtschaft in Wahrenbrück und diese mussten durch ein Tor gesichert werden.
Einnahmen von Wege-und Brückengeldern oder Geleitsgebühren an der Zollstation sorgten für ein aufblühen
der Stadt. Den Handelsleuten wurde dadurch sichere Zuflucht, ein Nachtlager und Futter für ihre Zugtiere
geboten.
Die alte Brücke
Über diese Brücke führte
eine der wichtigsten Heer-und Handelsstraßen von West nach Ost. Sicher ist diese auch im Zusammenhang mit
dem Bau des Klosters in Dobrilug zu sehen. Da sie durch eine Niederung ging, nannte man sie "Niederstraße"
im Gegensatz zur "Hohenstraße". Die "Zuckerstraße" führte von Altbelgern über Saxdorf, Wahrenbrück und
Rotstein nach Dobrilug.
Historische Stadt bzw. Ratsmühle
Mit dieser Schrift über
die an der Schwarzen Elster im Bereich der Stadt Wahrenbrück gelegenen Wassermühlen soll ihre Entwicklung
und ihre wahre Bedeutung in Bezug der Geschichte durch Alte Nachrichten bewahrt und lebendig gehalten werden.
Zu diesen gehören:• die ehemalige Historische Ratsmühle in Wahrenbrück, heute als Geneische Mühle
bekannt • die ehemalige Papiermühle in Wahrenbrück, heute als Ludwigs Mühle
bekannt • die ehemalige Neuemühle in Neumühl, heute eine Museumsmühle mit Hochpolgenerator.
| Alte Nachrichten von Wardenbrugk |
| 1005. Kaiser Heinrich II. Feldzug gegen Polen über Belgern, wahrscheinlich Jarina später gegenüberliegend Wahrenbrück nach Dobraluh. |
| 1011. Die Markgrafen Gero und Hermann, nebst dem Herzog Jarimir, gehen mit dem deutschen Heer von Jarina (bei Wahrenbrück) in die polnischen Grenzen, verwüsten Cilensi und Diedesi, und kommen bei der Gelegenheit an Glogau vorbei. |
| 1017. Brücken Erwähnung durch Thietmar von Merseburg. (Darauf fragten ihn die Boten: „Wie, wenn unsere Herren nun an die schwarze Elster kommen: willst du dann da sein?“ - „Auch die Brücke dort,“ antwortete er „kann ich nicht überschreiten.“ |
| 1092. Fränkische Kolonisten legten eine Menge Dörfer und Weiler (Villa) an und durften diese dann „Ihre“ ausgesuchten Namen geben. Wahrscheinlich, die Geburtsstunde von Wardenbrugk. |
| 1109. Feldzug gegen Polen Heinrich V. von Erfurt, Querfurt, Merseburg, Belgern, Jarina (Wahrenbrück), Doberlug in Richtung Glogow. |
| 21.Februar 1199. Kommt Hartbernus (Hartbern, Harprecht oder Harprechten) Priester in Wardenbrucke in Conradi marchionis orientalis confirmation der Dobrilugischen Grenzen, als Zeuge vor. |
| 18. Juli 1205. Hat Markgraf Conrad zu Lausitz auf Bitten Bischofs Dietrichs zu Meißen, eine Streitigkeit zwischen den Klosterbrüdern zu Dobrilug und Hartperten, Priestern zu Warenbrück beigelegt. Der besagte P. hat auf Zureden des Markgrafen alle Klage und Anspruch fallen lassen. Der Markgraf aber hat alle Grenzen auf das neue wieder Konfirmiert. Geschehen im Dorff Wardenbrück. |
| 2. April 1209. Ist des besagten Mgr. Conrads Gemahlin Elisabeth, Herzogs Miecislai in Pohlen Tochter gestorben, und zu Dobrilug begraben worden. Zu deren, und eignen Andenken hat Mgr. Conrad dem Kloster in seinen Dorfe Lubsch 16. Hufen, nebst den Ober-Gerichten darauf, in gleichen die Zehnden zweier Weinberge zu Belgern und Schlaberndorff verehret. Solches ist noch in diesem Jahre den 18. Dec. im Dorf Wardenbruck geschehen. Und da wird zum Schlusse des Briefes zum ersten mahl ein Abt, Adelbertus gemeldet. Ob er aber noch der allererste gewesen ist, das lässt sich nicht sagen. Diese Schenkung nebst dem Vergleich mit dem Pfarrer zu Wardenbrück hat Mgr. Dietrich zu Meißen und Lausitz, den Tag darauf confirmiret. |
| 1248. Hat das Kloster Dobrilug von Mgr. Heinrichen die Mühle zu Wardenbrück vor 54. Marck gekauft. |
| 6. Januar 1253. Heinrich, Markgraf von Meißen, bekundet, dass er dem Kloster Dobrilugk, um der Ergebenheit des Convents gegen ihn und die Seinigen willen das Patronatsrecht der Kirche zu Wahrenbrück, das zu seiner Schenkung gehöre, für ewige Zeiten und so verliehen habe, wie er und seine Vorfahren es bisher besessen, wobei Botho und Otto, Gebrüder v. Ileburg, Zeugen sind. Der hierüber ausgefertigte Brief war in Hrn. geh. Rath Ludwigs Reliqvien in das Jahr 1203. versetzt worden. Weil die Zeugen aber längst hernach erst gelebt, so hat ihn Herr Horn in dieses Jahr gesetzt, dabei ich auch bleiben lasse. |
| 8. Januar 1253. Bodo und Otto Gebrüder v. Ilburg sind Zeugen (vor ihnen Ulrich v. Pak, Heinrich d. I. Burggraf v. Dewin, nach ihnen: Albrecht Truchseß v. Borna) als in Meißen Heinrich, Markgraf von Meißen und Osterland dem Kloster Dobrilugk das Patronatsrecht über die Kirche zu Wahrenbrück bestätigt. (nach d. Kopialbuche d. Klosters) |
| 23. Juni 1276. Hat Abt Guncelinus, die neue Mühle bei Wahrenbrück an Alexandro von Beyersdorff verkauft für 26. Marck weißen Silbers, sich aber und dem Kloster folgende Stück vorbehalten. 1) Jährl. 16. Malter Korn Pacht zu geben. 2) Wenn das Kloster mahlen lassen will, andere zurück zu setzen. 3) Des Klosters Getreide nicht zu metzen. 4) Die Münche und Kloster-Leute, so oft es nötig, auf einen großen Kahn, welchen man damals Floß nennte, überzusetzen. 5) Wenn ein neuer Kahn zu machen, sollte er die eine, und das Kloster die andere Hälfte tragen. 6) Wegen der Zahlung gewisse Bürgen setzen. 7) Wenn er die Mühle wieder verkaufen will, solche dem Kloster zuerst anbieten. 8) Brenn-Holtz soll er auf denen Werdern fällen, so viel als nötig, große Bäume aber nicht, ohne Einwilligung des Klosters. Am elftausend Jungfrauen-Tage hat Burggraf Otte von Wittyn dem Kloster die Hälfte des Teichs Buckwitz vor 4. Marck Silber überlassen, und die andere Hälfte, die sein Vater dem Kloster geschenkt, er aber nicht gern hergeben wollen, auch endlich übergeben. |
| 15. Mai 1299. Otto, Sohn Bothos, Ritter, genannt der Jüngere v. Ileburg bekundet, dass der Streit mit dem Abte und Kloster zu Dobrilugk wegen einer neuen Mühle dahin geschlichtet sei, dass er um des Seelenheils seiner verstorbenen Gemahlin Luckardis willen, deren Gedächtniss der Convent stets feiern werde, die alte Grenze der neuen Mühle bei Wahrenbrück an der Elster dem Wunsche des Klosters gemäß erneuert und sich alles seines Rechtes daran für sich und seine Nachfolger begeben habe. (Termini vero in orto eiusdem noui molendini incipiunt et directe per ascenum versus Wardinbrucke iuxta agros rusticorum de Grabow vsque ad nigram Alestram protenduntur, cum interpositis ibi signis, sed et insulam, que vvlgari vocabulo Wird nuncupatur, cum utroque littore in eodem Alestre fluuio adiacente, tam ex parte superiori quam inferiori.) |
| 22. Februar 1300. Dietrich d. I., Landgraf von Thüringen, Markgraf des Osterlandes und der Lausitz, bekundet, dass sein lieber Vasall, Ritter Otto, Sohn Bodos, genannt der Jüngere v. Ileburg in seiner Gegenwart das Dorf Münchsdorf und die Mühle in Wahrenbrück, die er beide von ihm zu Lehen getragen, aufgelassen habe mit der Bitte, sie dem Kloster Dobrilugk zu übereignen. Dies erkläre er hierdurch und behalte sich und seinen Erben keine Rechte daran vor. |
| 5. Juni 1307. Otto genannt der Jüngere v. Ileburg, Herr zu Uebigau, verkauft dem Kloster Dobrilugk die Insel Namens Horst bei Wahrenbrück belegen, nachdem die Bauern zu Wahrenbrück allen ihren Rechten daran entsagt haben. |
| 2.September (c. 1309) wahrscheinlich 1307 -1310.
Otto genannt der Jüngere v. Ileburg bekundet zu Uebigau, dass das Kloster zu Dobrilugk von ihm eine Mühle und eine andere desgleichen an der Brücke, beide zu Wahrenbrück gelegen, gekauft habe zum allgemeinen Besten und insonderheit für die Bauern der Dörfer Woldenstorf, Marxdorf, Bönitz, Beyersdorf, Zinnsdorf, Wahrenbrück, Grabow, Roßdorf, Schilda, Wildgrube, Beutersitz, Rothstein und Winkel. Er verspricht, dass der Mahlbetrieb frei und ungehindert stattfinden solle und resignirt dem Kloster jährlichen Zins von einem Malter Getreide aus der Mühle zu Wahrenbrück, den Johann, der Sohn des Fleischers Albrecht, von ihm zu Lehen habe und den er fortan vom Kloster zu Lehen nehmen solle. Besiegelt auch mit dem Siegel seines Schwagers Johann v. Strele. |
| 27. Dezember 1321. Otto der Jüngere genannt v. Ileburg bekundet, dass das Kloster Dobrilugk sich mit Peter Sudecum, Arnold v. Schilda und Heinrich Balgschläger über die Mühle zu Wahrenbrück verglichen habe und besiegelt diesen Vertrag. |
| 24. Juni 1324. Hat Abt Theodericus und der Convent die Mühle zu Wardenbrück an Peter Sudecum, Arnolden von Schildow und Heinrich Balckschläger erblich verkauft, mit folgenden Conditionen: Sie sollen dem Kloster acht Jahr lang alle Viertel Jahre ein Schock Pragischer Groschen einantworten. Nach Verlauf derer acht Jahre soll es beim Abt und Kloster stehen, ob sie einen Eisenhammer oder Mahlmühle daselbst haben wollen. Was aber dem Kloster belieben möchte, so sollen die drei Männer von der letzten Jährlich 18. Luckauische Malter Korn geben, bei dem ersten aber sich wegen des Pachts mit dem Kloster vergleichen. |
| 5. Dezember (c. 1340). Otto genannt der Jüngere v. Ileburg Herr zu Sonnenwalde bekundet, daß die Streitigkeiten zwischen ihm und Dietrich, Abt des Klosters Dobrilugk, und seinen Vasallen und Unterthanen beigelegt seien, ausgenommen über die von ihm vor feiner Stadt Wahrenbrück erbaute Mühle und wegen gewisser zerstörter Grenzzeichen (Male) nach Schilda hin, worüber auf einem bis nächste Ostern anzuberaumenden Termine von vier zu erwählenden den Schiedsrichtern und einem Obmann verhandelt und das gehalten werden solle was diese für Recht erklären. |
| 29. November 1343. Otto der Jüngere genannt v. Ileburg Herr von Sonnenwalde und Wahrenbrück verkauft dem Abte Johannes und dem Convente des Klosters Dobrilugk zwei demselben nachtheilig gelegenen Mühlen für 40 Schock Groschen und verpflichtet sich, dass für die Folge dort von ihm und seinen Nachkommen weder Wind- noch Wassermühlen erbaut werden sollen, so dass die Klostermühlen bei Alt- und Neu-Wahrenbrück dadurch beeinträchtigt werden könnten, entsagt für sich und seine Nachfolger allen Rechten an den letzteren Mühlen und verspricht, es in deren Besitz zu schützen. Besiegelt von ihm und seinen leiblichen Brüdern Otto dein Aeltern von Ileburg, Herrn zu Sonnenwalde und Bodo v. Ileburg, Domherrn zu Merseburg. Zeugen sind die letztgenannten und mehrere Vasallen der Herren v. Ileburg. |
| 1384. Schloss, Stadt und Herrschaft Wahrenbrück wird von Botho Herrn v Jleburg dem Churhause Sachsen verkauft und dem v. Köckeritz zu Pfand gegeben. |
| 4. Dezember 1384. Poppo, Ritter und dessen Bruder Conrad v. Köckritz, auf Sathayn gesessen bekunden, dass Churfürst Wenzel und dessen Vetter Albrecht, Herzöge zu Sachsen und Lüneburg, ihr Schloss Wahrenbrück mit allen Rechten und Zubehör, wie es bisher Herr Botho v. Ileburg zu Lehen gehabt habe, für 942 Schock und 48 neue und für 1460 Schock und 22 breite böhmische Groschen an sie versetzt haben mit dem Rechte, es in den drei nächsten Jahren wieder einzulösen. Aller Schaden, der durch Kriege an den Besitzungen und dem Schloss angerichtet werde, solle von den Herzögen ersetzt werden. Für die Aufrechterhaltung dieser Verträge verbürgen sich Popp und Conrad v. Köckeritz, Sachwalter Herr Botho v. Ileburg, Erich Schenck zu Drebkau, Herr Witzmann, Herr zu Camenz und Herr Hans v. Elsterwerda, gegen die Herzöge von Sachsen und deren Treuhänder Herrn Gebhard Grafen von Schraplau, Otto Schencken v. Landsberg, Herrn zu Seyda, Herrn Mathias Falke, Herrn Otto v. Dybengen dem vier und achtzigstem Jahre an Sand Barbaren Tage, der heiligen Jungfrauen. Nach dem Original an dem die sechs ziemlich gut erhaltenen Siegel der Pfandnehmer und ihrer Bürger hängen, im K. Sachs. Haupt Staats Archiv zu Dresden. Die obige Urkunde ist deshalb auch von besonderem Interesse weil sie die Pertinenzen des Schlosses Wahrenbrück, das nun nicht mehr im Besitze der Herren v. Ileburg erscheint aufzählt. Die Ortschaften die zum Teil schon früher ihrer Lage nach bestimmt sind, liegen in der Umgegend von Wahrenbrück. Von den oben genannten Dörfern ist nur Grabow wüst, die andern Örter sind der Reihe nach Bönitz, Schmerkendorf, Marxdorf, Ciilsa, Zinsdorf, Kiebitz, Vorwerk von Falkenberg, Bomsdorf, Langennaundorf, Beutersitz und Wildgrube sämtlich im Kreise Liebenwerda Vgl. v. Köckeritz die Köckeritze im Voigtlande Meißen und Sachsen Mainz 1871. |
| Über die Schicksale des Schlosses finden wir keine Nachrichten; aus den Burghuten gingen besondere Rittergüter hervor, von deren Besitzern uns nur die v. Glaubitz (Glubozk) als Ileburgische Vasallen bekannt sind. 1339 war es der Herrschaftsbesitz der Herren v. I. selbst, Otto der Jüngere v. Ilburg und 1335 gehörte wahrscheinlich ein Johannes praefectus ebenfalls zu dieser Familie. Gegen Ausgang des 14. Jahrhunderts ging es durch Verkauf an die Markgrafen von Meißen und muss so sein Ende erreicht haben. Aus dem verfallenen Schloss, der „alten Burg“, ging das Rittergut hervor, das im 15. Jahrhundert (schon 1429) und die folgenden Zeit die v. Köckeritz besaßen. Es befand sich gleich nach der Kreuzung Richtung Herzberg auf der linken Seite. (siehe alte Karten). |
| 1421. Donnerstags nach Viti und Modesti einen Vergleich zwischen dem Pfarrer zu Wardenbrück und dessen Pfarrleuten stiften. |
| 1480. Nachdem Bischoff Johann der V. zu Meißen dem Kloster Dobrilug, Misnensis dioecesis, die Pfarr-Kirche zu Wartenbrugk, daran das Kloster zuvor die Disposition und Collation gehabt, einverleibet und zugeeignet, so haben dagegen der Abt, Prior, Subprior und Bursarius des Klosters bewilliget, dass sie alle Unterthänigkeit, Reverentz und Ehre, auch alle Bischöffliche und Archidiaconalische Gerechtigkeit, so dem Bischoff, seinen Nachkommen, auch dem Decano zu Meißen als Archidiacono, an obberührter Pfarrkirche gehörig, in keinem Wege entziehen, sondern gantz und unverletzt erhalten und erzeigen wollen, wie solches ein weltlicher Priester obberührter Pfarr-Kirchen iederzeit zu halten, und zu erzeigen schuldig. Sie und des Klosters Nachkommende sollen und wollen auch sich von dieser Zusage und gegebenem Treuen und Gelübnüß weder aus eigener Bewegung, noch durch jemandes anders, auch den Pabst selbst nicht absolvieren lassen. Freytag nach Conversionis Pauli. |
| Balthasar Kuschke, Abt. Wird bereits a. 1502. gemeldet. A. 1504. und 1505. hat er einen doppelten Vertrag zwischen dem Pfarrer zu Wartenbruck und seinen Pfarrleuten aufrichten helfen. Dieser Abt lebte noch a. 1522. und ist seinetwegen von Churfürsten zu Sachsen folgender Vertrag errichtet worden. |
| 1637. Brand zerstörte fast ganz Wahrenbrück |
| Seltsam ist, dass viele damals bedeutende Städte, wie auch Jarina in späterer Zeit keinen Aufschwung mehr hatten, sie vielen ins Bedeutungslose oder verschwanden. Ich vermute das der Hauptzweck der im Schutz der hiesigen Bevölkerung lag, die sie in den militärischen Anlagen der jeweils zur Zeit tributpflichtigen Herrscher suchten, wegfielen. Unsere Burg oder Schloss wurde angelegt wo die Verteidigung erleichtert und der Zugang erschwert war, vom jetzigen Standort Wahrenbrück hinter der Schwarzen Elster und das Sumpfland vor sich. Denn der Gegner waren die Deutschen, diese nutzten es später noch, doch der militärische Zweck war so nicht mehr erfüllbar. Die Brücke konnte schnell abgerissen werden, denn das Dorf existierte wohl nur als Weiler. Doch auch in jenen alten Zeiten war die Schwarze Elster Lebenswichtig für Jarina und später Alt-Wahrenbrück. Wir wissen nichts Zuverlässiges über die zurückliegende Vergangenheit und können uns daher nur an den heutigen Gegebenheiten orientieren. |